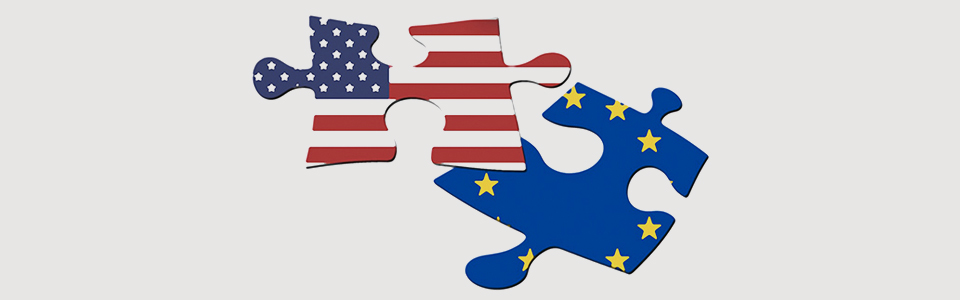
DIALOG
WIRTSCHAFTSDIALOG
Warten auf TTIP
Katharina Luise Kittler
Der Protest wird größer, die Fortschritte kleiner: Den Zeitplan für das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika können die Verhandlungsführer wohl nicht einhalten. Befürworter des Abkommens sehen darin aber auch eine Chance.
Nein, konkrete Ergebnisse konnte Ignacio Garcia Bercero am 18. Juli in Brüssel nicht vorstellen. Der Spanier führt im Auftrag der EU-Kommission die Verhandlungen zwischen der EU und den USA über das transatlantische Freihandelsabkommen, kurz TTIP. Nach der sechsten Verhandlungsrunde sprach Bercero von konstruktiven Gesprächen zwischen der EU und den USA und stellte fest, dass die öffentlichen Proteste gegen das Freihandelsabkommen von beiden Seiten sehr ernst genommen werden würden. Im Mittelpunkt der Gespräche hätten die Abschaffung von Zöllen und verschiedene Regulierungsmaßnahmen gestanden. Ein Fokus habe dabei auf Hygienestandards und Pflanzenschutz gelegen, so Bercero.
Der Chefunterhändler weiß: Die Zeiten für TTIP sind keine einfachen und da hilft Pessimismus wenig. Die öffentlichen Proteste nehmen sowohl in der EU als auch in den USA zu. Und auch der Zeitplan für die Verhandlungen war wohl zu optimistisch geplant. Als die Gespräche Anfang 2013 begannen, wünschten sich beide Seiten einen Abschluss des Abkommens bis 2015. Realistisch ist diese Zeitplanung nun nicht mehr. „Es ist nicht überraschend, dass die Verhandlungen zwischen der EU und den USA nun doch länger dauern sollen“, sagt Crister Garrett, Amerikanistik-Professor an der Universität Leipzig. Falls sich beide Seiten auf ein Freihandelsabkommen einigen, dann wird die größte Wirtschaftsregion der Welt geschaffen. „Dass es dafür mehr Zeit braucht, um alles zu regeln und festzulegen, ist nicht verwunderlich“, so der Professor.
Glück oder Gefahr?
Luisa Santos, Direktorin der Abteilung Internationale Angelegenheiten bei Businesseurope, teilt Garretts Auffassung. „In der Regel dauern solche Verhandlungen mindestens fünf Jahre. Alles andere wäre unnormal“, sagt Santos. Businesseurope ist ein europäischer Arbeitgeberverband mit Sitz in Brüssel. Der Verband vertritt rund 41 Mitgliedsverbände aus 35 europäischen Staaten und befürwortet die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Businesseurope erhofft sich vor allem Kostensenkungen für den internationalen Handel und damit verbundene neue Jobs. „Besonders kleine und mittelständische europäische Unternehmen würden von TTIP profitieren“, so Luisa Santos. „Die großen Unternehmen existieren bereits auf dem amerikanischen Markt. Für die anderen Firmen würden sich mit TTIP ganz neue Möglichkeiten für internationalen Handel erschließen“, stellte Santos fest. Durch die Abschaffung von Zöllen und anderen Barrieren müssten kleine und mittelständische Unternehmen weniger investieren und könnten so ihre Ressourcen schützen. Einen weiteren Vorteil gäbe es laut Santos auch auf politischer Ebene: „Mit TTIP bekommen wir die einmalige Möglichkeit, globale Standards zu setzen, an denen sich auch andere Wirtschaftsmächte wie zum Beispiel China orientieren würden.“ Dass die Verhandlungen durch den öffentlichen Protest verlängert oder gar abgebrochen werden könnten, glaubt Santos nicht.
Johannes Lauterbach von der TTIP-Kampagnengruppe bei Attac sieht das anders. Zusammen mit anderen Aktivisten der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation (NGO) protestiert er gegen das geplante transatlantische Freihandelsabkommen. „Es war von Anfang an unrealistisch zu planen, dass die Verhandlungen bis 2015 abgeschlossen werden. Ich rechne damit, dass es auch bis 2016 nicht klappen wird“, sagt Lauterbach. Es gebe erhebliche Interessenskonflikte zwischen den Verhandlungsführern und die könnten nicht in kürzester Zeit ausgeräumt werden. Lauterbach kämpft für einen Abbruch der Verhandlungen. Seine Argumente: Einen so dominanten transatlantischen Wirtschaftsblock zu kreieren schade wirtschaftlich schwächeren Staaten und koste weltweit Arbeitsplätze. Auch Bürgerinnen und Bürger der EU-Mitgliedsstaaten würden die negativen Konsequenzen des Freihandelsabkommens zu spüren bekommen: „Unsere Demokratie würde mit dem Abschluss von TTIP unter die Räder kommen“, so Lauterbach. Institutionen hätten dann noch schlechtere Möglichkeiten, regulierend auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen, um öffentliche Interessen durchzusetzen.
Professor Klaus Buchner, der einzige Europa-Abgeordneter der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), befürchtet mit dem geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den USA ebenfalls das Ende von Demokratie und Rechtsstaat. Laut Buchner werde in der Öffentlichkeit nur von den Vorteilen durch TTIP gesprochen und weniger davon, was die Unternehmen und vor allem die Bevölkerung zu verlieren hätten. „Die Öffentlichkeit wird mit falschen Statistiken über die möglichen Gewinne durch das Freihandelsabkommen getäuscht“, so der 73-Jährige. Vergleichbar sei TTIP mit NAFTA, dem Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Während die USA vor allem Jobs hinzugewonnen hätten, habe Mexiko weniger von der Freihandelszone profitiert. Ähnliches befürchtet der ehemalige Universitätsprofessor der TU München im Fall von TTIP.
Mehr Transparenz als Chance
Inhaltlich teilen die TTIP-Befürworter die Grundsatzkritik nicht – aber auch sie sehen Nachbesserungsbedarf. Die öffentlichen und politischen Proteste gegen das geplante Freihandelsabkommen könnten als eine Chance für die künftigen Verhandlungen gesehen werden, sagte Daniel Caspary, Europa-Abgeordneter der CDU, vergangene Woche im Europäischen Parlament. Die Kritik zeige die Notwendigkeit, mehr zuzuhören und die Öffentlichkeit besser über TTIP zu informieren. Ein erster Schritt in Richtung mehr Transparenz wurde bereits gemacht. EU-Handelskommissar Karel De Gucht stellte Verhandlungsdokumente für die Abgeordneten ins Internet. Einen weiteren Schritt könnte laut Caspary der Europäische Rat gehen, indem er das Verhandlungsmandat öffentlich macht. Dieses Mandat beinhaltet die Leitlinien und Eckpunkte der geplanten Freihandelszone. Bei TTIP gehe es nicht um die Schwächung von Standards oder Verbraucherrechten, sondern um einen verbesserten Marktzugang für europäische Unternehmen. Es sei essentiell, die Öffentlichkeit über diese und andere Inhalte der Verhandlungen zu informieren. Am Ende seiner Rede sagte Caspary: „Wir wollen TTIP, wir wollen es aber nicht um jeden Preis.“
Die Abkürzung TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership
Die europäische Kommission und Handelsbeauftragte der USA verhandeln über eine gemeinsame transatlantische Freihandelszone
Beide Seiten stehen im engen Kontakt mit Interessensvertretern (zum Beispiel Unternehmensverbände und Verbraucherorganisationen)
Das Abkommen, das aus den Verhandlungen hervorgeht, wird dann den jeweiligen Parlamenten (EU-Parlament und Kongress in den USA) zur Abstimmung vorgelegt
Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht vor allem der Abbau von Handelsbeschränkungen (zum Beispiel weniger Zölle)
Es soll einheitliche Testverfahren für Autos, Maschinen, Kosmetik und andere Produkte geben
Diese Maßnahmen sollen in der EU und in den USA zu mehr Wachstum und Arbeitsplätzen führen
Kritiker des Abkommens befürchten vor allem eine Herabsenkung der europäischen Standards
Die Verhandlungen starteten im Juli 2013
