
KULTURDIALOG
DIALOG
Unter Druck
Die Krise hat sie hart getroffen, aber die Journalisten in Thessaloniki haben noch nicht aufgegeben. Das Problem: Das System, in dem sie arbeiten, ist kaputt – und wird nur schwer zu reparieren sein.
Von Eike Hagen Hoppmann
Als der Tiefpunkt erreicht war, im September vergangenen Jahres, hatten die Beschäftigten der Tageszeitung „Makedonia“ an ihre Besitzer nur noch einen Wunsch: Wenn ihr uns schon nicht mehr bezahlen könnt, gebt uns wenigstens den Namen. Volle 17 Monate hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt unbezahlt für die Zeitung gearbeitet. Sie hatten von Ersparnissen gelebt, manche sogar vom Geld ihrer Eltern. Damit hörten sie nun auf – und „Makedonia“ musste eingestellt werden. Einige Mitarbeiter handelten aber mit den Eigentümern einen Deal aus: Sie verzichteten auf einen Teil ihrer ausstehenden Forderungen – und erhielten dafür die Rechte am Namen der Zeitung.
Denn „Makedonia“ ist nicht irgendein Name. Die Tageszeitung aus Thessaloniki hat eine über hundertjährige Geschichte und war die wichtigste – und am Ende letzte übriggebliebene täglich erscheinende Zeitung der Stadt. Mit dem Namen wollten die Journalisten einen Neuanfang beginnen: ohne die alten Eigentümer, dafür mit neuen Ideen. „Die Stadt hatte keine wirkliche Tageszeitung mehr“, sagt Sofia Christoforidou, die bei „Makedonia“ als Wirtschaftsredakteurin gearbeitet hat. „Wir haben gedacht, dass wir dagegen etwas tun müssen.“ Das Problem: „Wir hatten zwar den Namen, aber kein Geld“. Sie suchte den Kontakt zu lokalen Unternehmern und fand etwa 20 Unterstützer, die für einen Neustart Geld investierten.

Sofia Christoforidou
Seit September dieses Jahres erscheint „Makedonia“ wieder. 15 verbliebene Journalisten füllen sie – allerdings nur noch einmal wöchentlich als Sonntagszeitung. Eine Tageszeitung hat Thessaloniki also weiterhin nicht – und das als Metropolregion mit mehr als einer Million Einwohnern. „Niemand kauft mehr jeden Tag eine Zeitung“, sagt Christoforidou. Es gibt zwar ein kleines täglich erscheinendes Blatt. Diese wird aber in Umfang und Qualität nicht dem Anspruch einer Tageszeitung gerecht.
Immerhin gibt es in Thessaloniki trotz der schwierigen Situation noch immer engagierte und motivierte Journalisten, die weitermachen und den Journalismus in der Stadt in eine bessere Zukunft führen wollen. Aber das System dahinter ist kaputt. Zeitungen haben keine Idee, wie sie sich langfristig selbstständig finanzieren wollen. Und Webportale nutzen die Schwäche der Konkurrenz mit fragwürdigen Methoden aus, über die noch berichtet wird
Wie konnte es so weit kommen?
Die Strukturen in der griechischen Medienlandschaft sind schon seit Jahrzehnten problematisch. Die Medienhäuser gehörten einigen wenigen Unternehmern, die ihr Geld in anderen Bereichen verdienten und damit die defizitären TV-Sender und Zeitungen finanzieren konnten. Die Medien waren zwar nicht profitabel, sie konnten sie aber für politische und wirtschaftliche Einflussnahme nutzen. Die Besitzer waren an nationalen und nicht an lokalen Nachrichten interessiert, die Leser vor Ort wurden vernachlässigt. Geändert hat sich daran bis heute wenig.
In der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen liegt Griechenland weltweit auf Platz 74 – hinter Staaten wie Mauretanien oder El Salvador und sogar noch einen Platz hinter Ungarn, dessen Ministerpräsident Viktor Orban die freie Presse in den vergangenen Jahren schrittweise gleichgeschaltet hat.
Die Vertrauenskrise der griechischen Medien
Nirgendwo in Europa wird Medien so wenig getraut wie in Griechenland. 80 Prozent der Griechen sind laut einer Studie des Think Tanks „Pew Research Center“ mit ihnen unzufrieden. Zusammen mit Südkorea ist Griechenland demnach das einzige Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal denkt, Medien würden über Großereignisse gut berichten.
Wenn Nikos Panagiotou an gute Medien denkt, dann denkt auch er nicht an Griechenland. Er denkt an Deutschland. Das Programm der Deutschen Welle oder das Handelsblatt Morning Briefing seien zwei Beispiele für qualitativ hochwertigen und innovativen Journalismus. Griechenland? Eher weniger.

Nikos Panagiotou (credit: Nikos Panagiotou)
Panagiotou ist Assistenzprofessor für Journalismus an der Aristoteles-Universität Thessaloniki. Kollegen sagen von ihm, er schlafe nie und arbeite viel. „Journalismus in Griechenland befindet sich in einer schwierigen Phase“, sagt er. „Die Krise hatte darauf noch einmal sehr starke Auswirkungen.“
Auf der einen Seite habe die Krise zu sinkenden Werbeeinnahmen und niedrigeren Verkaufszahlen geführt. Weder Firmen noch Konsumenten hatten Geld. Auf der anderen Seite habe die Krise aber auch zu einem weiteren Vertrauensverlust geführt. „Die Leute haben das Vertrauen in die Institutionen und auch in die Medien verloren, weil sie als Teil des Establishments gesehen wurden.“ Zu einem großen Teil sei die Kritik zwar nicht gerechtfertigt, sie habe aber einen wahren Kern. „Medien hatten nicht die Unabhängigkeit, die für die Berichterstattung notwendig gewesen wäre.“
Auch das Nutzerverhalten hat sich weltweit geändert. In Griechenland ist der digitale Trend besonders stark. Laut dem „Reuters Institute Digital News Report“ aus dem vergangenen Jahr konsumieren 95 Prozent der Bevölkerung Nachrichten online, überwiegend auf Facebook. Nur in der Türkei werden durchschnittlich noch mehr Nachrichten-Websites genutzt als in Griechenland.
Zahlen möchte für die digitalen Informationen aber kaum jemand. Nur sechs Prozent der Bevölkerung sind laut Studie dazu bereit. Die Entscheidung stellt sich oft auch gar nicht erst, denn Paywalls gibt es kaum. Die Nutzer sind es gewohnt, dass sie die Informationen kostenlos erhalten. Es ist schwer, diese Erwartungshaltung zu ändern. Gleichzeitig werden in keinem Land mehr Ad-Blocker genutzt als in Griechenland. Mehr als die Hälfte der unter 35-Jährigen haben sie installiert, um Werbung zu unterdrücken.
Wie aus zwei Tageszeitungen keine wurde
Das waren die Rahmenbedingungen des Zerfalls. Erste deutliche Anzeichen des Niedergangs gab es bereits 2009, als bei „Makedonia“ die Gehälter der Mitarbeiter nicht mehr pünktlich gezahlt werden konnten. Es kam zu Teilzeitarbeit und 2012 musste die Produktion ein zweites Mal in der Geschichte der Zeitung gestoppt werden. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch eine andere Tageszeitung in der Stadt: „Agelioforos“. Die Situation von „Makedonia“ verbesserte sich anschließend wieder für ein paar Jahre, bis es 2015, am Höhepunkt der Krise, wieder kritisch wurde. „Da hatten wir nicht mal mehr genug Geld, um das Papier der Zeitung zu bezahlen“, sagt Christoforidou.

Ausgabe der neuen Makedonia
„Agelioforos“ überlebte das Jahr nicht mehr. Im Oktober 2015 musste das Blatt Insolvenz anmelden, 100 Mitarbeiter verloren ihren Job. „Makedonia“ schleppte sich noch ein paar Monate weiter durch, die Journalisten arbeiteten unter widrigsten Bedingungen. „Manchmal gab es nur 30 Euro Gehalt pro Woche“, sagt Christoforidou. „Manche von uns konnten sich noch nicht einmal mehr ein Busticket leisten, um zur Arbeit zu kommen.“ 2017 kam dann das vorläufige Ende.
Die Gründe sind vielseitig. Allgemeine Trends spielen eine Rolle, die speziellen Faktoren in Griechenland – aber auch lokale Besonderheiten. Der Norden Griechenlands wurde von der Krise zwar besonders stark getroffen. „Es fehlte in Thessaloniki aber auch schon vorher das Interesse an Nachrichten“, sagt Christoforidou. Man habe nie genau gewusst, was die Leser wirklich interessiert: die Themen des Landes oder die der Region. Das hänge auch mit der fehlenden Identität der Stadt zusammen, die sich noch immer nicht entschieden hat, ob sie eine Art zweite Hauptstadt neben Athen werden oder sich mit der Rolle als Nummer zwei abfinden will.
So haben die lokalen Zeitungen der Stadt nach und nach die Bindung zum Leser und ihre Bedeutung verloren. Eine repräsentative Umfrage in der Region aus dem Jahr 2016 ergab, dass 85 Prozent der Befragten keine Lokalzeitungen mehr lesen.
Die neue Konkurrenz
Ein weiterer Grund für „Makedonias“ Untergang trägt Bart, sportliches Sakko und hat das freundliche Lächeln eines Flugbegleiters. Tasos Aslanidis verantwortet „Thestival“, die größte und erfolgreichste Nachrichtenseite der Region. Eine Million Menschen besuchen die Seite jeden Monat. Aslanidis hat erst Fitness studiert, widmete sich dann aber lieber dem Journalismus. Zehn Jahre lang arbeitete er für einen lokalen TV-Sender, 2010 gründete er thestival.gr.
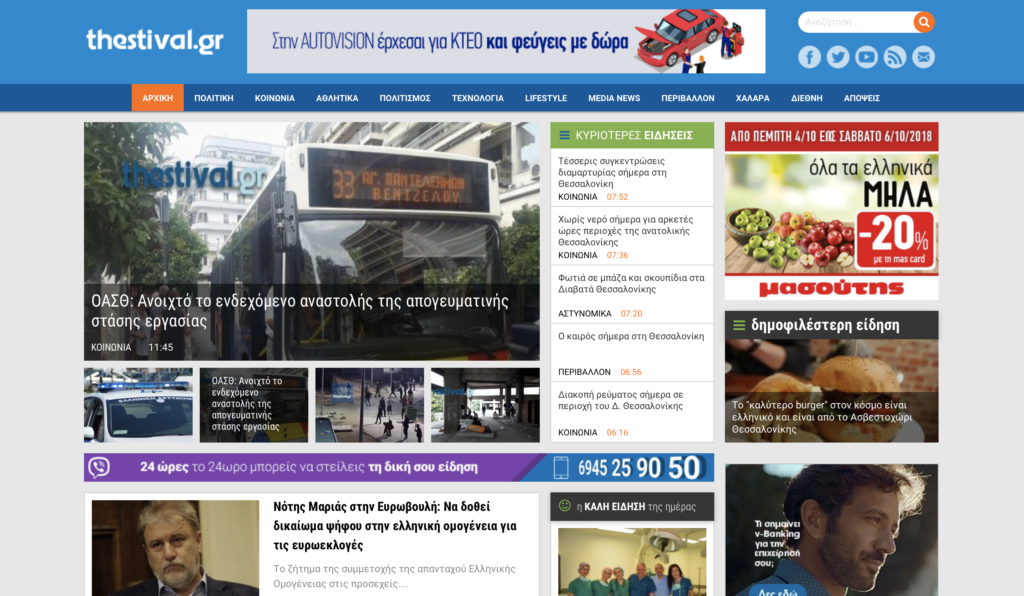
Website von Thestival
Was macht Aslanidis besser als andere? „Unsere Reporter sind auf der Straße, bei den Protesten, und nehmen für die Geschichte auch Risiken in Kauf“, sagt er. Aslanidis selbst wurde bei der Berichterstattung zu einer Demonstration im vergangenen Monat von der Polizei attackiert und gewürgt, der Fall sorgte international für Aufsehen.
Die „Thestival“-Redaktion ist klein. Nur sechs bis acht Redakteure beschäftigt Aslanidis. Damit das funktioniert, nutzen sie Hinweise aus der Bevölkerung. Leser können Videos oder Fotos hochladen. Es gibt außerdem eine Telefonnummer, bei der Leser anrufen und Neuigkeiten schildern können. Die Einbindung geht sogar so weit, dass Leser ihre eigenen Reportagen einschicken können. Das liefert haufenweise Inhalte für wenig oder gar kein Geld. Auch wenn Aslanidis sagt: „Wir müssen immer erst einen Weg finden, die Nachricht zu bestätigen, bevor sie veröffentlicht wird.“

Tasos Aslanidis während einer Recherche (credit: Tasos Aslanidis)
Die Seite ist für die Leser kostenfrei. „Unsere einzige Einnahmequelle ist Werbung“, sagt Aslanidis. Mehr Klicks bedeuten mehr Werbegelder – auch deshalb erscheinen auf „Thestival“ kurze und vor allem viele Artikel. Qualitativ hochwertig sind sie selten. „Die Leute wollen im Internet kurze Texte lesen und keine langen Analysen“, sagt Aslanidis. „Genau das bieten wir an.“
Zweifelhafte Geschäftsmodelle
Warum die News-Portale im Gegensatz zu Lokalzeitungen überleben können, zeigt sich auch am Beispiel von „Parallaxi“. Denn sie setzen zum Teil auf fragwürdige Geschäftsmodelle. „Parallaxi“ ist das älteste noch bestehende kostenlose Magazin der Stadt. Im kommenden Jahr feiert es 30-jähriges Jubiläum. Seit sieben Jahren wird auch eine Website mit lokalen Nachrichten betrieben, die monatlich 400.000 User besuchen.
„Parallaxi“ ist ein Familienunternehmen. Giorgos Toulas und seine Frau leiten die Geschäfte, zusätzlich gibt es fünf Festangestellte – und etwa 20 bis 30 freie Mitarbeiter. „Parallaxis“ Erfolg geht vor allem auf deren Kosten. Für Artikel auf der Website bekommen die Freien kein Geld. Nur für Artikel im monatlich gedruckten Magazin gibt es eine Entlohnung. Trotzdem schreiben dort viele überwiegend junge Journalisten, um Erfahrung zu sammeln und ihren Namen bekannter zu machen.
Wie „Thestival“ finanziert sich auch „Parallaxi“ über Werbung. Die klassische Werbung macht aber nur noch einen Teil der Einnahmen aus. Sogenannte „Sponsored Posts“ werden stattdessen immer wichtiger. Mitarbeiter werden zum Beispiel zu Restaurants geschickt und bieten diesen an, sie für eine bestimmte Summe in einem Artikel vorzustellen. Das Problem: Sie werden bei „Parallaxi“ nicht gekennzeichnet. Auf der Homepage sehen sie aus wie alle anderen Artikel auch. „Ich denke, dass die Leute heutzutage sehr clever sind und das verstehen“, sagt Toulas. Es ist nicht ganz zu erkennen, ob er selbst von seiner Antwort überzeugt ist.

Giorgos Toulas
Die kritische Phase hält Toulas inzwischen für beendet. „Die Situation verbessert sich inzwischen wieder, Anzeigenkunden kommen zurück“, sagt Toulas. Auch der Neustart von „Makedonia“ ist ein Zeichen in diese Richtung. Es ist allerdings fraglich, ob er gelingen wird. „Das Makedonia-Modell stirbt aus“, sagt Toulas. „Aber kostenlose Magazine werden die Leute immer lesen.“ Auch Aslanidis sieht das so. „Ich glaube nicht, dass Zeitungen in Thessaloniki überleben werden“, sagt er. Fühlt er sich mitschuldig für ihren Tod? „Nein, man kann mich nicht für die Evolution der Dinge verantwortlich machen. Wir müssen uns alle an die Bedürfnisse unserer Zeit anpassen. Für Zeitungen werden nur noch nostalgische Personen bezahlen.“
Warum der Neustart schwer wird
Damit man für „Makedonia“ bezahlen kann, müsste man sie zunächst aber erst einmal finden. Montagnachmittag, Gang durch die Innenstadt, immer dieselbe Frage am Kiosk an der Straßenecke: „Haben Sie Makedonia?“ Immer eine von zwei Antworten. „Nein, haben wir nicht.“ Oder: „Ja, haben wir. Aber nur bis Montagmittag. Danach schicken wir die nicht verkauften Ausgaben zurück.“ Wie will eine Wochenzeitung Erfolg haben, die nur eineinhalb Tage im Verkauf ist?
Es wäre weniger schlimm, wenn es nicht die nach wie vor wichtigste Verkaufsoption von Zeitungen in Griechenland wäre. „Die Leute kaufen ihre Zeitungen am Kiosk“, sagt Panagiotou. „Griechische Zeitungen haben es nie geschafft, ein funktionierendes Abo-Modell zu entwickeln.“ Das Ergebnis: Eine mittlere vierstellige Zahl an Exemplaren verkauft „Makedonia“ aktuell per Woche.
Einige Sachen hat man dort im Vergleich zur alten Ausgabe geändert, viel ist es nicht. „Wir machen Babyschritte“, sagt Christoforidou. Es gibt ein neues Layout, ein paar neue Kolumnen und man wollte innovatives Storytelling ausprobieren. Inhaltlich hat sich vor allem eins geändert: „Wir versuchen so viele lokale Geschichten wie möglich zu machen“, sagt Christoforidou. Man will aus alten Fehlern lernen.

Redaktionsräume von Makedonia
Grundlegende Fehler der alten Zeitung hat man dagegen übernommen: Es fehlt nicht nur an einem Abo-Modell, sondern auch an einer Digitalstrategie. Es gibt keine Paywall, die Artikel aus der Print-Ausgabe werden leicht verzögert kostenlos auf die Website geladen. Damit kannibalisiert sich die Zeitung selbst. „Ich zahle nicht für etwas, das ich woanders umsonst bekomme“, sagt Professor Panagiotou.
Das größte Problem aber ist wohl die Finanzierung. Die ist zwar anders als früher, aber nicht unbedingt besser. Besitzer der neuen „Makedonia“ sind die Mitarbeiter und lokalen Investoren gemeinsam. Wie aber berichten, wenn einer dieser Geldgeber in einen Skandal verwickelt ist? „Darüber denke ich viel nach“, sagt Christoforidou. „Wir sollten fair berichten und nicht verstecken, wenn es einen Skandal gibt.“ Noch gab es einen möglichen Interessenkonflikt nicht, die Zeitung ist aber auch erst seit vier Wochen zurück auf dem Markt. Falls es irgendwann dazu kommen sollte – wie glaubwürdig ist „Makedonia“ dann? Man müsste eigentlich schnell unabhängig werden, aber bei den beschriebenen Problemen wird das schwierig. 4000 verkaufte Exemplare reichen dafür nicht.
Was Thessaloniki in der Medienlandschaft einzigartig macht
Einerseits folgt die Situation in Thessaloniki einem generellen Trend: Leute lesen mehr im Internet und kaufen weniger Zeitungen. Es gibt aber auch eine Besonderheit in der Region: Der Stadt gehört ein Radio- und Fernsehsender. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf lokaler Ebene also. „Das gibt es so in dieser Art im Rest Griechenlands nicht“, sagt Panagiotou „Der Sender gehört zu den besten des Landes.“ Ein bekanntes Gesicht dort ist Irini Tsarouha – und im Vergleich zu den deutschen Kollegen der Öffentlich-Rechtlichen ist sie um ihre Arbeit nicht zu beneiden.

Irini Tsarouha
Wenn Caren Miosga wissen möchte, wie die Tagesthemen-Sendung am Vorabend beim Zuschauer angekommen ist, schaut sie sich die Quoten an. Wenn Tsarouha sich dieselbe Frage stellt, muss sie sich auf ihr Gefühl verlassen. Tsarouha, etwas raue Stimme, drei Zigaretten pro Stunde, ist Moderatorin einer täglichen Nachrichtenshow beim lokalen Sender TV100, der sich auf Themen rund um Thessaloniki konzentriert. Die Finanzierung durch die Stadt ist ein Vorteil, einerseits. „Wir haben dadurch nicht die Probleme von Zeitungen wie Makedonia“, sagt Tsarouha.
Aber es ist eben auch ein Nachteil. Die Abhängigkeit von öffentlichen Geldern bedeutet, dass TV100 auch vom Memorandum betroffen ist. Das Budget wurde gekürzt, der Sender darf keine neuen Leute mehr einstellen und muss sparen, wo es geht. Zum Beispiel bei der Quotenmessung: „Wir bekommen keine Informationen darüber, wie viele Leute uns sehen. Die Messungen würden zu viel Geld kosten“, sagt Tsarouha. Was als Feedback bleibt, sind Kommentare in den sozialen Medien. Mehr nicht.

Newsroom von TV100
Kurze Führung durch Studio und Newsroom des Senders, Interview auf dem Balkon. TV100 ist im Gebäude des Nationaltheaters Nordgriechenlands untergebracht. Von dort oben in der sechsten Etage hat man einen weiten Blick über die Stadt. Tsarouha nimmt auf einem wackligen Plastikstuhl Platz, der kurz vor dem Zusammenbruch steht. Er steht da auf dem Balkon wie ein Symbol der Medienlandschaft in Thessaloniki. Im Vergleich zur Zeit vor der Krise verdient sie 40 bis 45 Prozent weniger – und arbeitet täglich zwei Stunden mehr. Parallel kümmert sie sich auch noch um den Abschluss ihres Masterstudiums, das sie neben der Arbeit angefangen hat. Warum hat sie nicht längst mit dem Journalismus aufgehört? „Ich liebe meinen Job“, sagt Tsarouha.
Es ist ein Satz, den man unter Journalisten in Thessaloniki häufig hört. „Journalismus ist Liebe“, sagt auch Christoforidou. Aber Liebe macht irrational. Und manchmal blind. Für den Journalismus in Thessaloniki ist das ein Problem.
Wie die Zukunft gelingen kann
Viele Ideen, die für die Zukunft des Journalismus insgesamt gelten, lassen sich natürlich auch auf Thessaloniki übertragen. Ein paar Bereiche sind aber von besonderer Bedeutung für die Region: An erster Stelle steht die Erarbeitung einer nachhaltigen Digitalstrategie. Mit Kioskverkäufen wird keine Zeitung überleben können, Abhängigkeit von externen Geldgebern schadet zusätzlich dem Vertrauen. “Wir müssen verstehen lernen, dass man für guten und unabhängigen Journalismus bezahlen muss”, sagt Panagiotou. In dieser Hinsicht haben Griechenland und Thessaloniki Nachholbedarf. Eine Paywall und ein digitales Abomodell sind für das langfristige Überleben notwendig. Für kurze Artikel und News wird das nicht funktionieren. Die werden bereits von Portalen wie “Thestival” zur Zufriedenheit der Nutzer abgedeckt.
Dafür fehlt es in Thessaloniki an Angeboten mit Qualitätsjournalismus. Diese Lücke müssen Zeitungen wie “Makedonia” füllen, Portale wie “Thestival” werden das nicht tun. Wenn sich im Journalismus noch mit etwas Geld verdienen lässt, dann mit aufwändig recherchierten Geschichten. “Die Lösung für die Krise des Journalismus ist es, zurück zur Basis zu gehen. Und die Basis des Journalismus ist Recherche”, sagt Panagiotou.
Zu einer digitalen Strategie gehört auch die Nutzung von Social Media. Das ist für Journalismus weltweit ein oft wiederholtes Mantra geworden, gilt aber in besonderem Maß für Griechenland, wo ihre Bedeutung besonders hoch ist und auch die Newsportale häufig über Posts bei Facebook angesteuert werden. “Die Leser müssen ihre Nachrichten dort bekommen, wo sie sich aufhalten”, sagt Panagiotou. Der Kiosk ist es immer seltener.
Social Media ist aber nur ein Teil eines breiteren Konzepts. Insbesondere Lokaljournalismus braucht wieder eine stärkere Verbindung zu den Lesern. “Man muss vor Ort sein und die Leser einbinden”, sagt Panagiotou. Genau das machen Portale wie “Thestival” und genau dort liegt der Schlüssel ihres Erfolgs. Nähe bedeutet auch die Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und daran fehlt es griechischen Medien vielleicht sogar noch mehr als am Geld.
